
100 km/h sind nicht 28 m/s
Warum fast alle falsch runden – und was sauberes Rechnen wirklich bedeutet
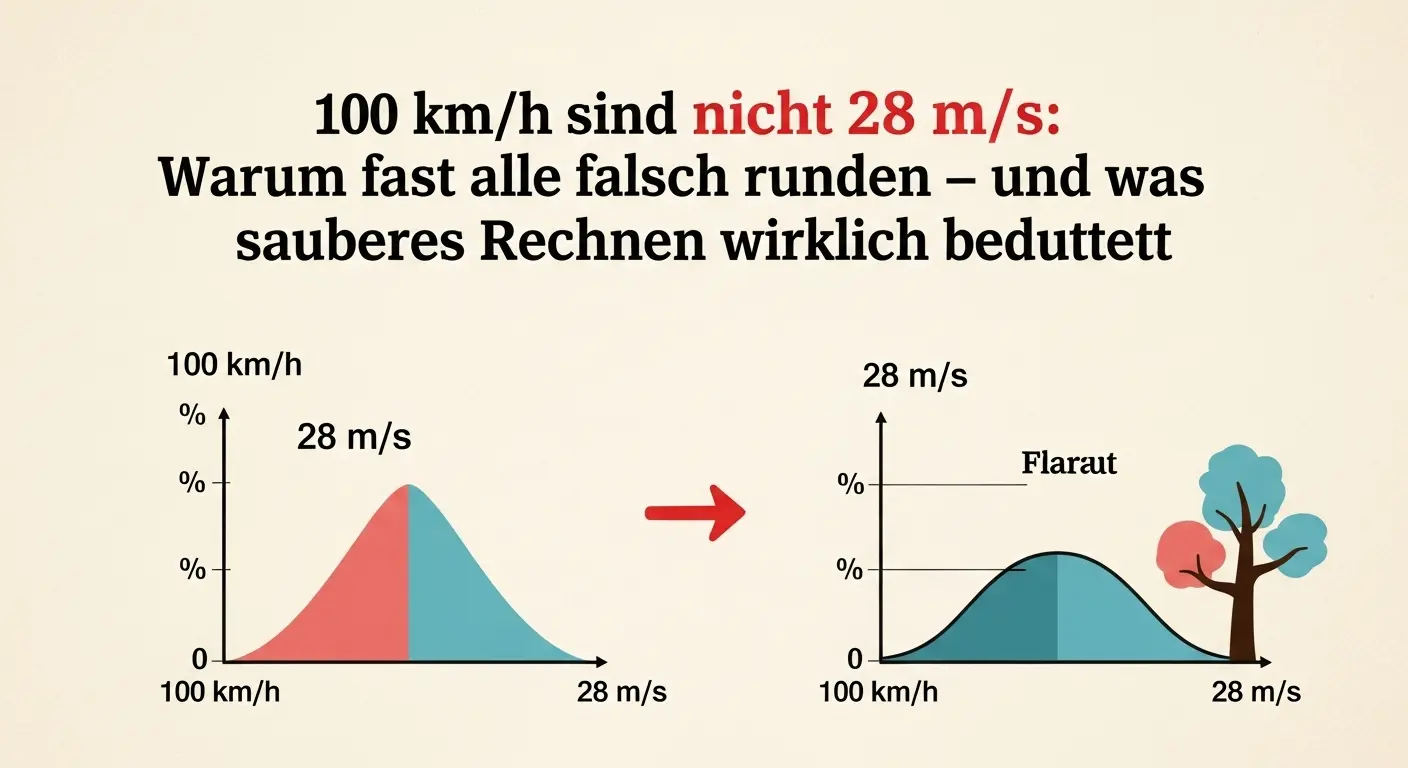
100 km/h sind nicht 28 m/s: Warum fast alle falsch runden – und was sauberes Rechnen wirklich bedeutet
Warum die scheinbar einfache Umrechnung so oft schiefgeht
Viele von uns haben im Kopf die bequeme Faustformel: 100 km/h sind etwa 28 m/s. Praktisch für den schnellen Überschlag – aber genau genommen falsch, wenn Präzision gefordert ist. Dahinter steckt kein Spitzfindigkeitsspiel, sondern ein grundlegendes Prinzip: Runden erst am Ende, nicht zwischendurch. Wer Zahlen zu früh abschneidet, schleppt den Fehler in alle weiteren Schritte. In Bildung, Technik und Verkehrssicherheit ist das nicht trivial. Messwerte werden verglichen, Sicherheitsmargen kalkuliert, Reaktions- und Bremswege abgeleitet. Eine zu grobe Rundung kann die Bewertung von Risiken verzerren und zu falschen Entscheidungen führen. Die richtige Umrechnung lautet: 100 km/h geteilt durch 3,6 ergibt 27,777… m/s, korrekt auf zwei Dezimalstellen gerundet 27,78 m/s. Genau hier entsteht der verbreitete Irrtum: Aus einem Zwischenwert von 27,8 wird im Kopf „auf ganze Zahlen“ schnell 28 – eine zweite Rundung, die in vielen Kontexten kein methodischer Schritt, sondern eine Ungenauigkeit ist. Wer die Logik hinter Einheiten, signifikanten Stellen und Rundungsregeln einmal sauber verstanden hat, rechnet nicht nur exakter, sondern argumentiert konsistenter – in Klassenarbeiten, in technischen Zeichnungen und in Besprechungen, in denen Entscheidungen auf Zahlen fußen.
Die Logik hinter 3,6: Einheiten, Genauigkeit und der Mythos vom „ungefähren Richtig“
Die Umrechnung zwischen km/h und m/s ist ein Paradebeispiel dafür, wie Mathematik, Physik und Alltagssprache einander missverstehen können. Kilometer sind tausend Meter, Stunden sind 3600 Sekunden – also ist 1 km/h = 1000/3600 m/s = 1/3,6 m/s. Daraus folgt unmittelbar: Teilen durch 3,6 bringt uns von km/h nach m/s, Multiplikation mit 3,6 zurück. So weit, so simpel. Der Teufel steckt im Detail der Darstellung. Wenn wir 100 durch 3,6 teilen, erhalten wir 27,777…; das ist eine periodische Dezimalzahl. In Wissenschaft und Technik gilt: Man rundet erst nach der letzten Rechenoperation und richtet die Anzahl der Dezimalstellen nach der Messgenauigkeit des Ausgangswerts oder der geforderten Darstellung. Wenn also 100 km/h als glatter, aber begrenzt genauer Wert vorliegt (häufig ohne Dezimalen), ist 27,8 m/s eine legitime Angabe mit einer Dezimalstelle; 27,78 m/s ist korrekt mit zwei Dezimalstellen; 28 m/s ist nur dann sinnvoll, wenn ausdrücklich auf ganze m/s gefragt ist oder wenn es sich um einen groben Überschlag handelt. Das Problem beginnt, wenn wir die pragmatische Näherung „100 km/h ≈ 28 m/s“ als „korrekt gerundet“ verkaufen. Ein Überschlag bleibt ein Überschlag – nützlich zur Orientierung, aber kein Ersatz für exaktes Arbeiten. Wer etwa Reaktionswege und Bremswege modelliert, summiert kleine Differenzen – und genau dort akkumulieren Rundungsfehler. Unterrichtspraktisch lohnt es sich, diese Feinheiten transparent zu machen: Nicht, um pingelig zu sein, sondern um zu zeigen, wie aus sauberen Grundsätzen gute Entscheidungen werden. Denn die Sprache der Zahlen hat Regeln, und wer sie beherrscht, argumentiert fairer und nachvollziehbarer.
Grundlagen zur Umrechnung und zum sauberen Runden
-
1 km = 1000 m; 1 h = 3600 s; daher 1 km/h = 1000/3600 m/s = 1/3,6 m/s.
-
Umrechnung: v[m/s] = v[km/h] ÷ 3,6; umgekehrt v[km/h] = v[m/s] × 3,6.
-
100 km/h ÷ 3,6 = 27,777… m/s; auf zwei Dezimalstellen: 27,78 m/s.
-
Rundungsregel: Erst nach der letzten Rechenoperation runden; Dezimalstellen an Aufgabenstellung oder Messgenauigkeit anpassen.
-
Typische Referenzen: 3,6 km/h = 1 m/s; 36 km/h = 10 m/s; 72 km/h = 20 m/s; 180 km/h = 50 m/s.
-
Überschlag vs. Ergebnis: „≈ 28 m/s“ ist als Näherung ok; „= 28 m/s“ ist nur korrekt, wenn ganze m/s gefordert sind.
Praxisnahe Tipps für Schule, Studium und Technik
Wer mit Zahlen arbeitet, braucht einfache, robuste Routinen. Erstens: Schreibe Einheiten konsequent mit – sie disziplinieren die Rechnung. Steht dort „km/h ÷ 3,6“, ist der Weg klar. Zweitens: Nutze für Zwischenschritte nach Möglichkeit den vollen Rechnerwert oder ausreichend viele Dezimalstellen, runde erst am Ende. Drittens: Kläre die Genauigkeitsanforderung. Wenn eine Aufgabe „auf zwei Dezimalstellen“ verlangt, gilt das für das Endergebnis. Wenn die Eingangsdaten nur auf eine signifikante Stelle genau sind, spiegelt das die Präsentation des Ergebnisses. Viertens: Trainiere reflexartige Ankerwerte wie 36 km/h = 10 m/s. Diese fixen Punkte verkürzen Kopfzeit und erhöhen Sicherheit, ohne die Genauigkeit zu opfern. Fünftens: Dokumentiere Annahmen. Notiere „Überschlag“ oder „auf ganze m/s gerundet“, wenn du bewusst grob näherst – so bleibt die Kommunikation klar. Sechstens: Wenn Reaktions- oder Bremswege berechnet werden, prüfe Sensitivitäten. Ändert sich das Ergebnis spürbar, wenn du zwischen 27,78 und 28 m/s wechselst? Wenn ja, ist grobe Rundung fehl am Platz. Siebtens: Prüfe Einheitenkonsistenz bei Formeln. Einfache „Einheitenalgebra“ verhindert, dass aus m/s plötzlich km/h werden. Achtens: Arbeite mit Rechencodes oder Taschenrechnerfunktionen, die Gleitkommafehler minimieren, und runde erst bei der Ausgabe. Diese kleinen Praktiken sind ein Schutz vor systematischen Fehlern – und ein Qualitätsmerkmal professionellen Arbeitens.
Fakten
-
Im Straßenverkehr entspricht 100 km/h exakt 27,777… m/s; die korrekte Rundung auf zwei Dezimalstellen ist 27,78 m/s.
-
In Prüfungen und technischen Dokumenten ist es Standard, erst nach Abschluss aller Rechenschritte zu runden.
-
Signifikante Stellen richten sich nach der Messgenauigkeit der Eingangsdaten; „glatte“ km/h-Angaben sind oft nur näherungsweise exakt.
-
Überschlagsrechnungen (z. B. 100 km/h ≈ 28 m/s) sind zulässig, müssen aber als Näherungen gekennzeichnet werden.
-
Fehlerhafte Rundung kann in sicherheitsrelevanten Berechnungen kumulative Abweichungen erzeugen.
FAQ
Frage: Ist 28 m/s bei 100 km/h wirklich „falsch“?
Antwort: Als grobe Näherung ist 28 m/s in Ordnung. Als korrekt gerundeter Wert auf zwei Dezimalstellen ist es jedoch falsch; korrekt sind 27,78 m/s. Auf ganze m/s darfst du auf 28 runden, wenn das explizit gefordert ist.
Frage: Warum teilen wir durch 3,6 und nicht durch 3,5?
Antwort: Weil 1 km = 1000 m und 1 h = 3600 s. 1000/3600 = 1/3,6. Das ist die exakte Verhältniszahl zwischen km/h und m/s.
Frage: Woran erkenne ich, wie viele Dezimalstellen ich verwenden soll?
Antwort: An der Aufgabenstellung und an den Eingangsdaten. Wenn eine Aufgabe „zwei Dezimalstellen“ fordert, gilt das für das Endergebnis. Sind die Eingangsdaten grob, ist auch das Ergebnis begrenzt genau.
Frage: Was sind typische Kopfanker für die Umrechnung?
Antwort: 3,6 km/h = 1 m/s; 36 km/h = 10 m/s; 72 km/h = 20 m/s; 108 km/h = 30 m/s. Diese Eckwerte helfen, Größenordnungen schnell einzuschätzen.
Frage: Spielt das in der Praxis wirklich eine Rolle?
Antwort: Ja, wo Ergebnisse weiterverwendet werden – etwa bei Bremswegabschätzungen, Energie- und Leistungsberechnungen – können wiederholte Rundungen systematisch nach oben oder unten verschieben.
Weiterführende Links
-
Umrechnung von Geschwindigkeitseinheiten und Rundungsregeln in der Physik
-
Signifikante Stellen: Leitfaden für Messunsicherheit und Darstellung
-
Mathematische Rundungsverfahren: Bankers Rounding vs. kaufmännisches Runden
-
Praxisbeispiel Verkehr: Reaktions- und Bremswege und ihre Abhängigkeit von v in m/s
-
Didaktik-Tipp: Einheitenalgebra und Fehlersensitivität im Unterricht
Kritik: Über Genauigkeit, Pragmatismus und die Ethik der Zahl
Es ist bequem, sich mit „ungefähr richtig“ zufriedenzugeben. Wer 28 m/s sagt, signalisiert Handlungsschnelligkeit – und genau die wird im Alltag oft belohnt. Doch Präzision ist kein Luxus, sondern Verantwortung. Zahlen tragen Entscheidungen, und jede Entscheidung hat Folgen. Die Kunst besteht darin, zu wissen, wann Genauigkeit geboten ist. Eine Gesellschaft, die Komplexität systematisch „glättet“, riskiert, Risiken zu unterschätzen – und Vertrauen in Zahlen zu verspielen.
Gleichzeitig wäre es unsinnig, jede Alltagskommunikation zu verrechtlichen. Sprache lebt von Näherungen, mentale Modelle brauchen einfache Anker. Die Leitplanke sollte nicht „immer maximal exakt“, sondern „methodisch ehrlich“ lauten: Nenne es Überschlag, wenn es einer ist; nenne es Ergebnis, wenn du es als solches verantworten kannst. Diese Unterscheidung stärkt die Diskurskultur – vom Klassenzimmer bis zur Vorstandsetage.
Als früherer wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich erlebt, wie kleine methodische Sauberkeiten große Debatten entgiften. Wenn wir Einheiten sauber führen, Rundungen kennzeichnen und Annahmen transparent machen, diskutieren wir weniger über Personen und mehr über Sachverhalte. Das ist nicht pedantisch, sondern demokratisch: Es macht Argumente überprüfbar und Entscheidungen nachvollziehbar.
Fazit: Kleine Zahlen, große Wirkung
Die Umrechnung 100 km/h → 27,78 m/s ist mehr als eine Schulaufgabe. Sie ist ein Lehrstück darüber, wie wir mit Zahlen umgehen sollten: Einheiten konsequent führen, erst am Ende runden, Genauigkeit an den Kontext koppeln und Näherungen als solche benennen. „28 m/s“ ist als Überschlag nützlich, als „korrekt gerundet“ aber irreführend. In Bildung, Technik und Verkehrssicherheit ist diese Unterscheidung entscheidend, weil kleine Rundungsfehler sich addieren und die Realität verzerren können. Wer klare Regeln anwendet und Annahmen transparent macht, stärkt die Qualität von Entscheidungen – und das Vertrauen in die Sprache der Zahlen. Präzision ist kein Selbstzweck. Sie ist ein Dienst an der Sache.